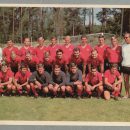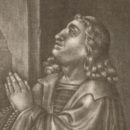Dass der Krieg verloren war, dürfte nüchtern denkenden Menschen von Monat zu Monat, die der ungebrochene Vorstoß der Alliierten andauerte, klarer geworden sein. Doch so nüchtern dachte längst nicht jeder. Noch immer gab es auch in Nürnberg Menschen, die von der Ideologie des Nationalsozialismus überzeugt waren und seine Positionen und Parolen vertraten. Fast fünf Jahre war man nun den Krieg gewohnt, die Rationierung von Gütern des täglichen Bedarfs, die Propaganda und Luftangriffe.

Ausgangslage
Die Namen von Städten, in denen sich Bodentruppen bewegten, waren dabei lange Zeit vielen unbekannt und teils in fremden Sprachen. Doch nun kamen die Bewegungen auf einmal näher und die Frontstädte wurden immer vertrauter. Wurde eine Stadt oder ein Kreis schließlich zum rückwärtigen Operationsgebiet erklärt so war vielen klar, dass auch der Frontstatus nicht mehr lange auf sich warten lassen würde, denn nicht berufstätigen Frauen, alten Menschen und Kindern wurde geraten, solche Gebiete zu verlassen. Für Nürnberg war dies am 7. April der Fall, nachdem Würzburg schon von den amerikanischen Truppen eingenommen war.
Tatsächlich sollte es nun nur noch etwa eine Woche dauern, bis die Amerikaner auch vor Nürnberg standen. Eine wichtige Rolle spielte hierbei die Einnahme von Lauf an der Pegnitz, die weitestgehend kampflos erfolgte und wo sich die Amerikaner von Osten für die Einnahme Nürnbergs neu ordneten. Von hier erreichten sie dann auch mit Erlenstegen den ersten Nürnberger Stadtteil.
Die Stadt war zur Verteidigung schlecht aufgestellt. In seiner Rolle als Befehlshaber des Wehrkreises XIII mit Sitz in Nürnberg hatte General Karl Weisenberger bereits viele auch eingeschränkt kriegstaugliche Männer ausgehoben, so dass aus der Bevölkerung eigentlich nur noch Volkssturm und Hitlerjugend zur Verfügung standen, jeweils mit nach oben bzw. unten gedehnten Altersbeschränkungen. Reguläre Truppen der Wehrmacht hatten sich aus taktischen Gründen teils nach Süden bewegt, um nicht in Nürnberg eingeschlossen zu werden.
Noch am besten aufgestellt war die 17. SS-Panzergrenadierdivision Götz von Berlichingen, die nach erheblichen Verlusten nach Nürnberg verlegt worden war. Übrig blieb ein Regiment mit einer Truppenstärke von 500 Mann. Von den insgesamt 7.500 Verteidigern bestand die Hälfte aus teils mit ausländischen Kräften besetzter Flak, Soldaten in Ausbildung, Volkssturm und Wehrmachtsdienststellen. Der Mangel an Ausrüstung machte sich nicht nur im Fehlen von Waffen, sondern auch von Kommunikationsmitteln bemerkbar. Bis in die letzten Tage behinderten zudem Mehrfachstrukturen aus Verwaltung (Oberbürgermeister Willy Liebel), Militär (Kampfkommandant Oberst Richard Wolf) und Partei (stv. Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Karl Holz) die Umsetzung einer einheitlichen Linie.

Kampfhandlungen
Von allen Seiten kreisten die amerikanischen Truppen ab dem 15. April Nürnberg ein, bis zum 16. April war die Aufstellung weitestgehend beendet, bot jedoch noch einige Lücken, durch die sich einzelne Personen noch absetzen konnten. Zunächst näherten sich die Amerikaner durch die Vororte der Stadt. Von den 100.000 Soldaten, die ihnen für diese Operation zur Verfügung gestanden hätten, mussten sie letzten Endes nur auf ungefähr ein Drittel zurückgreifen. Als sich der Ring um die Stadt schloss, war es nach Hitlers sogenanntem Nero-Befehl zur Selbstzerstörung relevanter Infrastruktur eigentlich geboten, wesentliche noch bestehende Industrieanlagen in der Stadt zu sprengen. Dem stand der Oberbürgermeister kritisch gegenüber und in einem stillschweigenden Einvernehmen las der für die Lageberichte im Rundfunk zuständige Wachtmeister Arthur Schöddert, wegen seiner beruhigenden Stimme im Volksmund auch Onkel Baldrian genannt, die Code-Nachricht nicht vor. So blieben nicht nur Industrieterrains, sondern auch große Mengen an Lebensmitteln erhalten, die in den Kühlhäusern der Linde AG eingelagert waren.
In den folgenden vier Tagen rückten die Amerikaner in die Stadt ein, wobei sich die Kämpfe am 17. und 18. April im Wesentlichen in den Vororten und am 19. und 20. April in der Altstadt vollzogen. Trotz der enormen qualitativen und quantitativen Übermacht an Mensch und Gerät zeigte sich dabei immer wieder, dass der Häuserkampf auch für die Amerikanischen Truppen schwierig war. Mehrmals gelang es den unterschiedlichen Gruppen der deutschen Verteidiger, sie in kleinem Umfang aus dem Hinterhalt ein Stück zurückzudrängen, zuletzt mit einer kleinen Gruppe unter Leitung von Karl Holz persönlich am 19. April auf der Insel Schütt.
Letztlich ließ sich die Einnahme jedoch nicht mehr verhindern. Holz zog sich mit den letzten verbliebenen Kampfeswilligen in seinen Gefechtsstand im Palmenhofbunker beim Polizeipräsidium zurück. Während dieser noch belagert wurde, fand auf dem damals zum Adolf-Hitler-Platz umbenannten Hauptmarkt am symbolträchtigen 20. April, Hitlers Geburtstag, eine erste amerikanische Siegesparade statt. Am späteren Abend verließen die letzten Unentwegten den Palmenhofbunker und begaben sich ins Polizeipräsidium wo Holz und Liebel umkamen. Oberst Wolf hingegen war, nachdem er die Einstellung der Kampfhandlungen befohlen hatte, von den Amerikanern gefangengenommen worden.

Stunde Null
Schon einen Tag zuvor war aus seiner Wohnung in der Bülowstraße der stellvertretende Bürgermeister Walter Eickemeyer von einem amerikanischen Offizier abgeholt und zum Kommandeur der Besatzungstruppen gebracht worden. Dort erhielt er den Auftrag, die Leitung der Stadtverwaltung fortzuführen. Für die Bevölkerung spürbar wurde dies erst zum 27. April 1945, als mit einer Direktorialverfügung an das Personalamt die städtischen Mitarbeiter wieder zum Dienst bestellt wurden. Bereits am 22. April wurde Eickemeyer nach seiner politischen Überprüfung wieder entlassen und interniert. Als Nachfolger wurde Stadtrat Julius Rühm eingesetzt, der aufgrund seiner Vorbelastung nach wenigen Wochen im Juli 1945 wieder entlassen und durch den Sozialdemokraten Martin Treu ersetzt wurde.
Die Tage zwischen dem 20. und dem 27. April waren auch die mit der größten Unübersichtlichkeit in der Stadt, die sich vor allem in Plünderungen bemerkbar machte. In der Überlieferung taucht hierbei immer wieder auch der Verweis auf ausländische Personen auf. Bei der Frage, wer diese waren muss man sorgsam differenzieren. Zwar war am 17. April 1945 die Befreiung des Kriegsgefangenenlagers in Langwasser erfolgt. Auch in den Verteidigungstruppen befanden sich jedoch sogenannten Hilfswillige (Hiwis) aus anderen Nationalitäten. Wurde die Einnahme Nürnbergs als Befreiung aufgefasst? Mit Blick auf die Einstellung von Bombardements, Häuserkämpfen und Repressalien durch unterschiedliche Formen von Standgerichten und Kriegsendphaseverbrechen war dies ganz unmittelbar sicherlich zunächst einmal der Fall. Bei einer Gesamtbewertung darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass vielen Nürnbergerinnen und Nürnbergern zwischen den von der NS-Propaganda ausgegebenen Schreckensszenarien eines Besatzungsregimes und anderslautenden Berichten die Orientierung darüber fehlte, wie die kommende Zeit wohl aussehen würde. Insofern wurde die Situation insgesamt, auch angesichts der amerikanischen Siegesparaden und der anfänglichen Strenge des Besatzungsregimes wohl eher ambivalent bewertet. Schon sehr bald gab es mit der Einweisung Schwerkranker in amerikanische Militärlazarette und vor allem einer Begegnung auf religiöser Ebene jedoch erste Basen der Kommunikation, auf denen sich im weiteren Verlauf aufbauen ließ.