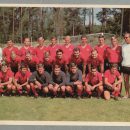Gastbeitrag von Dr. Matthias Klaus Braun, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Geschäftsbereich Kultur der Stadt Nürnberg
Zwölf Jahre Amtszeit
„Er werde dafür sorgen, daß diese Stadt wieder werde, was sie einst war: das Schatzkästlein Deutschlands,“ und „nimmer werde diese Stadt zerstört, wenn ihr einig seid und treu. Darum die Fahnen hoch!“
„In diesen Trümmern beginne ich nun wieder mit meiner Arbeit – ich hatte mir die Rückkehr nach Nürnberg anders vorgestellt!!“
Zwischen den Zitaten des Nürnberger Oberbürgermeisters Willy Liebel (1897–1945) aus dem März 1933 und dem Februar 1945 liegen fast genau zwölf Jahre. In dieser Zeit hatte der Nationalsozialist die Stadtverwaltung geleitet, geholfen, Andersdenkende zu verfolgen und insbesondere die jüdischen Einwohner zunächst zu diskriminieren und schließlich mithilfe der Deportationen in die Vernichtungslager ihrer Habseligkeiten und Wohnungen zu berauben und zu ermorden. Unter den Umständen des deutschen Angriffs- und Vernichtungskrieges kamen auf Liebels Betreiben geraubte Kunstschätze aus den Niederlanden, der Tschechoslowakei und Polen nach Nürnberg. Seine Ankündigung, die Stadt zum „Schatzkästlein Deutschlands“ zu machen, erschöpfte sich nicht allein im Bemühen um die Bewahrung der mittelalterlichen Altstadt – oder was die Nationalsozialisten für bewahrenswert hielten, wie sich angesichts des Abrisses der Hauptsynagoge am Hans-Sachs-Platz gezeigt hat. Die Rekonstruktion eines ideologisch definierten Nürnberg-Bildes setzte sich in Liebels Eifer bei der Umsetzung der Bauplanungen von Adolf Hitler (1889–1945) und Albert Speer (1905–1981) auf dem entstehenden Reichsparteitagsgelände im Südosten Nürnbergs fort. Die Konsequenz aus diesem Handeln war zunächst die moralische Zerstörung des alten Nürnberg-Bildes als Hort des Humanismus und der Künste, der die physische im Zuge des nationalsozialistischen Kriegskurses und der weitestgehenden Zerstörung der Stadt folgte.

Rückkehr in Trümmern
Mit Kriegsbeginn am 1. September 1939 waren sogenannte Reichsverteidigungskommissare eingesetzt worden, die fortan alle zivilen Angelegenheiten im Sinne der Verteidigungsbereitschaft zu entscheiden hatten. In Personalunion übernahmen zumeist die jeweiligen regionalen Anführer der NSDAP, die Gauleiter, diese Funktion. Für Nürnberg übernahm Karl Holz (1895–1945) ab November 1942 das Amt des Reichsverteidigungskommissars. Willy Liebel war als Stadtoberhaupt zu diesem Zeitpunkt bereits in Berlin und leitete für den zum Rüstungsminister aufgestiegenen Albert Speer das Zentralbüro in dessen Ministerium. Alle Informationen, die an Speer gerichtet waren, sowie dessen Weisungen einschließlich der tödlichen Ausbeutung von Kriegsgefangenen, zivilen Zwangsarbeitern und KZ-Insassen für die deutsche Rüstungsindustrie liefen über Liebels Schreibtisch. Im November 1944 trat Liebel zermürbt über Intrigen im nationalsozialistischen Herrschaftsapparat und gesundheitlich stark angeschlagen von seinem Amt zurück.

Willy Liebel kehrte zu Jahresanfang 1945 zunächst ins Ferienhaus der Familie im Nürnberger Umland zurück. Vom Karrierehöhepunkt in der Reichsbürokratie in Berlin ging es nun für Liebel in rasanter Fahrt bergab. Der Kriegsverlauf hatte sich mittlerweile eindeutig gegen seine nationalsozialistischen Verursacher gewandt. Als wichtige Industriestadt und Verkehrsknotenpunkt rückte damit auch Nürnberg in den Fokus. In den Worten des britischen Bomberkommandos galt die Stadt als „ein politisches Ziel erster Ordnung und eine der heiligen Stätten des Nazi-Glaubens“. Ein alliierter Luftangriff hatte bereits am 21. Februar 1942 die Familiendruckerei samt Wohnhaus der Eltern von Willy Liebel, Ausgangspunkt des gesellschaftlichen Aufstiegs der Familie im späten 19. Jahrhundert, zerstört. Liebel selbst nahm offiziell am 26. Februar 1945 wieder seine Amtsgeschäfte auf „in einer Zeit, die ohne Zweifel die sorgenvollste, bitterste und schicksalschwerste in Nürnbergs Geschichte ist.“ Auf Beobachter wirkte das Stadtoberhaupt in jenen Wochen „wie ein von einem Kinnhaken getroffener Boxer“. Unabhängig von der eigenen Erschütterung und den sichtbaren Zerstörungen ließ er das städtische Personal im fortdauernden NS-Jargon wissen, dass „auch wir durch rastlose und unermüdliche Arbeit dazu beitragen, die Voraussetzungen zu schaffen für den deutschen Sieg, der allein […] uns retten kann vor der uns vom Weltjudentum zugedachten Versklavung, Verschleppung und Vernichtung!“ Im Falle von Zweifeln machte das Stadtoberhaupt klar: „Etwaige Zerfallserscheinungen und Willkürakte müssen rücksichtslos im Keim erstickt, Nachlässigkeit nachgeordneter Organe darf unter keinen Umständen geduldet werden.“ Liebel lag damit ganz auf Linie des NS-Regimes und seines einstigen Rivalen Karl Holz. Der sagte von sich: „Ich bin Reichsverteidigungskommissar, nicht Reichsunterwerfungskommissar.“ Beide Männer waren im Umfeld des mittelfränkischen Gauleiters Julius Streicher (1885–1946) in der NSDAP während der Zwanzigerjahre zu herausgehobenen Ämtern gekommen, pflegten seither aber eine tiefgehende Abneigung zueinander. Erst mit dem drohenden Ende vor Augen änderte sich das.
Rivalisierende Bunkergemeinschaft
Am 15. April 1945 war Willy Liebel letztmals bei seiner Familie außerhalb Nürnbergs. Von seiner Frau und den Kindern verabschiedete er sich im Wissen, dass er nicht mehr lebend wiederkehren würde. Seinen Angehörigen empfahl er, bei Herannahen US-amerikanischer Truppen Gift zu nehmen, um diesen nicht lebend in die Hände zufallen. Mit diesem Bewusstsein war für Liebel klar, dass eine Gefangennahme für ihn persönlich nicht in Frage kam. Schon seit dem 7. April 1945 galt Nürnberg aus militärischer Sicht als „rückwärtiges Operationsgebiet“. US-Truppen hatten mittlerweile Würzburg erreicht und dann am 17. April zuerst aus nördlicher Richtung das Nürnberger Stadtgebiet. Bereits am Vortag hatte die Stadtverwaltung offiziell ihren Dienst eingestellt. Nachdem der verheerende Luftangriff vom 2. Januar 1945 den Rathausbereich am früheren Hauptmarkt zerstört hatte, residierte die Stadtspitze vorläufig im Bieling-Schulhaus. Dort erreichte Liebel am 16. April eine telefonische Aufforderung zur Kapitulation, die er unbeantwortet ließ. Für solche Situationen hatte Holz zwei Tage zuvor noch bekanntgegeben, „Verräter […], die weiße Fahnen hissen, verfallen unweigerlich dem Tode und werden aufgehängt.“ Außerdem plante der Reichsverteidigungskommissar, Hitlers „Nero-Befehl“, also die Zerstörung von Brücken und Kraftwerken, in die Tat umzusetzen, um dem heranrückenden Gegner keinen Nutzen an der zivilen Infrastruktur zu belassen. Glaubhaft ist von mehreren an den Geschehnissen Beteiligten bezeugt, dass Liebel sich hier gegen Holz gestellt hat. Für die verbleibende Zivilbevölkerung hätte eine solche Zerstörungstat nicht nur die aktuelle Lage weiter verschlimmert, sondern auch einen Wiederaufbau erheblich erschwert.

Am 18. April 1945 zogen sich Liebel und Holz gemeinsam mit den militärischen Vertretern der Wehrmacht in den Bunker am Paniersplatz zurück. Dass beide dort nach jahrzehntelanger Abneigung zum freundschaftlichen „Du“ fanden, spricht mehr für die Aussichtslosigkeit der Lage als für eine späte Aussöhnung. Für Holz war klar, dass er und Liebel „unter allen Umständen in Nürnberg zu bleiben und lieber kämpfend zu fallen, als diese Stadt zu verlassen“ hätten. Im Tagesverlauf des 19. April wechselten beide mit einer kleinen Gruppe ein letztes Mal den Standort und verschanzten sich im Palmenhofbunker unter dem Polizeipräsidium am Jakobsplatz. Über den genauen Ablauf der weiteren Stunden gehen die Berichte auseinander.
Die letzten Stunden
Während Holz scheinbar rastlos im Umfeld des Bunkers mehrere Angriffsversuche gegen die vorrückenden US-Truppen unternahm, verblieb Liebel im unterirdischen Innern. Seine Stimmung schilderten Beobachter nach Kriegsende als zunehmend fatalistisch und depressiv. Zuletzt scheint der militärische Kommandeur in der belagerten Stadt, Oberst Richard Wolf (1894–1972), Liebels Gesprächspartner gewesen zu sein. So habe ihm das Stadtoberhaupt anvertraut, „er wolle der Welt nicht das Schauspiel bieten, in einem Schauprozeß als Oberbürgermeister der Stadt der Reichsparteitage aufzutreten.“ Mit dem nun abwesenden Holz habe er daher vereinbart, dass im Falle einer Verwundung der jeweils andere dem „Kampfunfähigen […] den letzten Dienst erweisen“ solle, also „Tötung auf Verlangen“, um der Gefangennahme zu entgehen. Anschließend habe sich Liebel niedergeschlagen in das für den örtlichen Luftschutzleiter vorgesehene Dienstzimmer zurückgezogen. Von dort hörte Wolf kurz darauf einen Knall und fand Liebel schließlich in den frühen Morgenstunden des 20. April 1945 tot vor. Als Holz wenig später von einem Vorstoß wieder in den Palmenhofbunker zurückkehrte, wies er die dort Anwesenden an, Liebels Tod nicht als Selbstmord bekanntzumachen. Stattdessen sollte das Ableben des Stadtoberhaupts als Folge von Kampfhandlungen deklariert werden, um die Kampfmoral auf deutscher Seite nicht zu gefährden. Unter anderem diese Propagandalüge sowie das allgemein bekannte Wissen über die öffentlich ausgetragene Feindschaft zwischen beiden, zuletzt in Sachen „Nero-Befehl“, führte dazu, dass unmittelbar nach Kriegsende die Meinung vorherrschte, Holz habe Liebel erschossen. Mehrere US-amerikanische Zeitungen griffen dies auf, obwohl es hierfür außer Mutmaßungen keinen Beleg gibt.
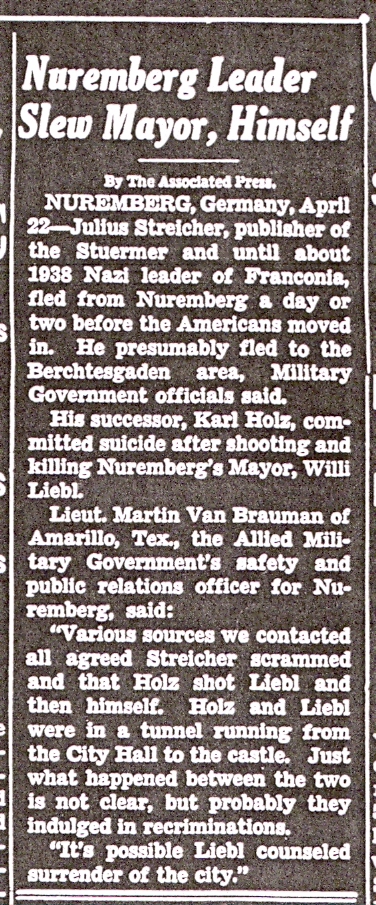
Holz selbst verschanzte sich nach seiner Rückkehr in den Palmenhofbunker und dem Auffinden von Liebels Leichnam mit wenigen Getreuen in den Trümmern des darüberliegenden Polizeipräsidiums. Während am Nachmittag des 20. April die US-Truppen bereits eine erste Siegesparade am Hauptmarkt abhielten, wurde noch bis in die Abendstunden um das Polizeipräsidium gekämpft. Erst als auch Holz nicht mehr am Leben war, endeten die Gefechte und damit auch die NS-Herrschaft in Nürnberg. Schwer verwundet hatte er sich in den Trümmern selbst erschossen. Dass dieser Tag zugleich auf Adolf Hitlers 56. Geburtstag fiel, war ein symbolischer Zufall. Die Bilanz von zwölf Jahren NS-Herrschaft in Nürnberg nimmt sich erschreckend aus. Von zuvor bei Kriegsende rund 423.000 Einwohnern waren im Frühjahr 1945 nur noch gut 195.000 in der Stadt verblieben. Bedeutende Bevölkerungsgruppen wie die jüdische Gemeinde, die im 19. Jahrhundert maßgeblich zum wirtschaftlichen Aufstieg der Industriestadt beigetragen hatte, waren von den Nationalsozialisten ermordet worden, ins Ausland geflüchtet und existierten nicht mehr. Bei Luftangriffen auf Nürnberg in Folge des deutschen Angriffskrieges waren insgesamt 6.726 Personen ums Leben gekommen und das weitestgehend erhaltene spätmittelalterliche Stadtbild nahezu komplett zerstört worden. 38,8 Prozent aller Gebäude im Stadtgebiet waren vollständig zerstört, davon knapp die Hälfte des bisherigen Wohnraums. Fast unbeschädigt erhalten blieben dagegen die großteils unfertigen Bauten auf dem im Südosten gelegenen Gelände der dort bis 1938 abgehaltenen nationalsozialistischen Reichsparteitage. Zeugen die Bauwerke noch sichtbar von den Friedensjahren des NS-Regimes und seinen Propagandainszenierungen sind die daraus resultierenden lokalen, nationalen und globalen Folgen von Tod und Zerstörung nicht davon zu trennen. Auch wenn die physischen Schäden in der Vergangenheit längst behoben sind, bleibt die Mahnung an deren Ursache und die Aufklärung darüber Verpflichtung für Gegenwart und Zukunft – gerade in Nürnberg im Zwiespalt der Stadtgeschichte zwischen kulturellem „Schatzkästlein“ und vormaliger „Stadt der Reichsparteitage“.