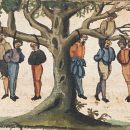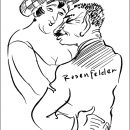Das Medium der Kleinbilddias wird bis heute gerne der Hobbyfotografie zugeordnet. Mit den Farbdias verbindet man vor allem gemütliche Abende, an denen Projektor und Leinwand im Wohnzimmer aufgebaut wurden, um die mit der Kamera festgehaltenen Eindrücke von Urlaubsreisen oder privaten Feiern im Familien- und Freundeskreis vorzuführen. Als Mitte der 1930-er Jahre nahezu zeitgleich die US-amerikanische Firma Kodak und das deutsche Unternehmen Agfa die ersten massentauglichen Farbdiafilme auf den Markt brachten, waren sie zunächst vor allem bei Amateuren beliebt, die sich damit erschwingliche Farbbilder leisten konnten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Farbdias vermehrt im Profibereich zum Einsatz. (Abb. 01)
Aus privaten Nachlässen stammende Dias gehören daher zu den recht häufigen Abgaben, die das Archiv erhält, und der private Charakter der Aufnahmen kann durchaus einen besonderen Blick auf eine Stadt eröffnen. Eine im Sinne eines Denkmalarchivs und im Rahmen der offiziellen Stadtbildfotografie angelegte Diasammlung besitzt das Stadtarchiv Nürnberg. Der Bestand „A 55 – Hochbauamt, Colordias“ wurde von der 1993 aufgelösten Bildstelle des Hochbauamts übernommen. In der Stadtverwaltung waren ab der Jahrhundertwende um 1900 eigens angestellte Fotografen damit beschäftigt, für die Arbeit der städtischen Bauämter in den Bereichen Stadtplanung und Denkmalpflege die Topografie und Architektur Nürnbergs mit dem Schwerpunkt historische Altstadt und kommunale Neubauten zu dokumentieren. Waren bei diesen Fotografen bis in die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Glasplattennegative in Gebrauch, ab den 1930-er Jahren zunehmend ergänzt durch die leichter handhabbaren Plan- und Rollfilme, so kam in der Nachkriegszeit mehr und mehr der Farbdiafilm zum Einsatz. (Abb. 02)
Thematisch deckt sich daher der Bestand an farbigen Kleinbilddias mit den Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Bei ihrer Arbeit hatten die Fotografen stets zwei Kameras dabei – die eine war mit einem Negativfilm ausgestattet, die andere mit einem Farbdiafilm versehen. Der Grund lag in den unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten der Medien: Die Schwarz-Weiß-Negativfilme waren zur Archivierung gedacht, die davon erstellten Abzüge bildeten die Grundlage für eine Vorlagensammlung, die nach Altstadt und Vorstadt klassifiziert und alphabetisch nach Straßennamen geordnet der Bauverwaltung für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt wurden. Mit den Farbdias wurde die verstärkte Nachfrage von Medien und Werbung nach Farbbildern bedient, zusätzlich wurden sie für Vorträge im Rahmen städtischer Veranstaltungen benötigt. Dies erklärt auch die weitaus geringere Anzahl an Dias gegenüber dem Negativmaterial, da sie lediglich als eine Art Nebenprodukt betrachtet wurden. Während sich das gesamte von der Bildstelle übernommene Negativmaterial auf weit über 500.000 Einzelbilder beziffern lässt, umfasst die Diasammlung „A 55“ rund 25.000 gerahmte Einzeldias im Format 24mm x 36mm. (Abb. 03 und 04)
Thematisch widmen sich Dias wie Negative den baulichen Veränderungen des Stadtraums: Neben den erhalten gebliebenen und wiederhergestellten historischen Gebäuden wurden die neu entstandenen Bauten und Denkmäler festgehalten und auch ganze Straßenzüge und Plätze abgelichtet. Ab den späten 1960-er Jahren galt das Interesse vermehrt städtischen Großveranstaltungen, wie dem Albrecht-Dürer-Jahr 1971, der Open-Air-Musikveranstaltung Bardentreffen oder dem alle zwei Jahre stattfindenden „Tag der offenen Tür“ der Stadt Nürnberg. Eine Identifizierung der Urheber kann bei den Dias nur durch den Vergleich mit den Kontaktabzügen der Negativfilme erfolgen, da bei Letzteren neben genauen Ortsangaben und dem oftmals tagegenauen Aufnahmedatum auch den Namen des Fotografen festgehalten wurden. Die Angaben auf den Dia-Rähmchen hingegen sind summarisch; sie enthalten lediglich den Straßennamen und das Aufnahmejahr. (Abb. 05)
Ein Beispiel für einen solchen Bildervergleichs liefern die Ansichten des Aufseßplatzes, die im Juli 1970 sowohl auf Kleinbildnegative als auch auf Farbdiafilm gebannt wurden. Dank der Schwarz-Weiß-Kontaktabzüge, auf denen der Name Gertrud Gerardi (1914–2002) festgehalten ist, kann man ihr die im selben Zeitraum entstandenen Farbdias der Platzanlage zuordnen. Die repräsentative Anlage, beliebter Treffpunkt für die Bewohner der Südstadt, war wegen des 1895 dort aufgestellten Nymphenbrunnens immer wieder Bildthema. Der Fotografin gelingt aber mehr als nur eine topografische Erfassung: Sie stellt mit der im Vordergrund abgelichteten Personengruppe die in den 1970-er Jahren sich verändernde Lebenssituation in der Südstadt dar. Damals begann sich die Bevölkerungsstruktur des Stadtteils durch die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte aus dem Süden und Südosten Europas zu wandeln. (Abb. 06a und 06b)
Mit Gerardi, die von 1969 bis 1974 die Bildstelle des Hochbauamts leitete, etablierte sich ein neuer Stil in der Stadtbildfotografie. Zuvor war sie als Bildjournalistin bei den Nürnberger Nachrichten tätig. Als eine der ersten Frauen in diesem Fach hatte sie Zeitungsverleger Bruno Schnell (1929–2018) nach Nürnberg geholt. Sie brachte eine eher am Situativen orientierte Sehweise in die bis dahin meist sachlichen, auf die Architektur oder den Straßenraum konzentrierten Aufnahmen ein, wobei es sich bei Ihren Straßenszenen nicht ausschließlich um Momentaufnahmen handelte, manchmal griff sie zugunsten einer lebendigen Bildgestaltung inszenierend ein. In den 1970-er Jahren finden auch Stilexperimente und neue Sehformen Eingang in die offizielle Stadtbildfotografie: Immer wieder kann man Aufnahmen entdecken, bei den das Fisheye-Objektiv eingesetzt wurde, auch Spiegelungen werden zu einem beliebten Motiv bei Straßenszenen. (Abb. 07)
Die kleinen gerahmten Bildchen sind ein besonderer Fotoschatz, der durch seine Farbigkeit nicht allein Stadtbild und Stadtgeschichte Nürnbergs in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebendig werden lässt, sondern auch ein Stück weit Fotogeschichte vermittelt. Der Bestand ist inzwischen erfasst und für Interessierte über die FAUST-Datenbank zugänglich, in die auch die komplett digitalisierten Dias eingebunden sind. Die ungewöhnlich langen Nummernfolgen der Signaturen, die aus römischen und arabischen Ziffern bestehen, spiegeln die einstige Aufbewahrung in Diaschränken mit Schiebfächern wider.
Wer den nostalgischen Reiz dieses Mediums schätzt, dem sei unsere im Sutton Verlag erschienene Bildbandreihe „Nürnberg in Farbe“ empfohlen. Gerade ist der dritte Band „Nürnberg in den Wirtschaftswunderjahren“ erschienen, der rund 160, größtenteils noch unveröffentlichte Farbdias aus den Jahren zwischen 1945 und 1969 enthält. Die Zeitreise führt in die Jahre des Wiederaufbaus und lassen das mit dem Wirtschaftsaufschwung einhergehende neue Lebensgefühl der Stadtbevölkerung lebendig werden. Das Buch ist für den Preis von € 36,99 ab sofort im Buchhandel erhältlich.
Das Gebäude am Hauptmarkt 16 wurde 1957/58 als modernes Büro- und Geschäftshaus errichtet. Die sandsteinverkleidete Fassade korrespondiert mit der sachlichen Architektur des Rathausneubaus. Foto Hochbauamt, um 1958. (StadtAN A 55 Nr. I-13-6-4)
Der Kaufhof in der Königstraße eröffnete im Jahr 1950 als erstes Warenhaus nach dem Zweiten Weltkrieg und war das größte bauliche Einzelprojekt der ersten Wiederaufbaujahre. Die rasterartige Fassadengestaltung rief damals heftige Kontroversen hervor. Foto Hochbauamt, Oktober 1963. (StadtAN A 55 Nr. I-20-15-7)
1891 wurde der städtische Schlachthof von der Altstadt nach Sündersbühl verlegt, wo er bis zu seiner Schließung 1997 in Betrieb war. In den 1950-er und 1960-er Jahren erfolgte eine umfangreiche Modernisierung des Geländes. Foto Hochbauamt, September 1958. (StadtAN A 55 Nr. III-28-6-5)
Die Bartholomäuskirche im Stadtteil Wöhrd. Der Handwerkervorort Wöhrd wurde im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört. Unter Beibehaltung der alten Straßenführung wurde er modern wiederaufgebaut. Foto Hochbauamt, Juni 1961. (StadtAN A55 Nr. III-41-11-4)
Seit 1971 findet ab Mitte September das Altstadtfest statt. Während die Verkaufsmesse auf dem Hauptmarkt die Besuchermassen anzieht, finden die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften auf der Insel Schütt Platz. Foto Hochbauamt, 1977. (StadtAN A 55 Nr. V-35-3-10)
Die Szene mit den Vätern und Kleinkindern am Aufseßplatz wurde einmal auf einem Kleinbildnegativ, einmal auf einem Colordia festgehalten. Fotos Hochbauamt: Gertrud Gerardi, Juli 1970. (StadtAN A 40 Nr. L-1030-17A und A 55 Nr. II-2-6-10)
Im September 1973 wurde der „Baui“ in Langwasser eröffnet, der Kindern selbstbestimmtes und kreatives Spielen ermöglichen sollte. Blick über das Hüttendorf des Bauspielplatzes. Foto Hochbauamt: Gertrud Gerardi, September 1973. (StadtAN A 44 Nr. IV-40-15-9)