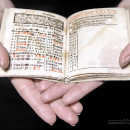Die Gründung des 1. FC Nürnberg und erste Sportplätze
Der 1. Fußballclub Nürnberg wurde am 4. Mai 1900 gegründet. Die Vorläufer des Fußballs finden sich in Nürnberg im 19. Jahrhundert, initiiert durch Schüler der beiden humanistischen Gymnasien und ihre Turnlehrer. Man orientierte sich zunächst am englischen Rugby, ging dann aber zum Fußball über. Im Frühjahr 1900 fand auf Initiative von Christoph Heinz (* 1877), dem späteren Präsidenten des 1. FCN, eine Versammlung von ehemaligen Schülern im Wirtshaus „Zur Burenhütte“ in der Deutschherrnstraße 11 statt. Ihren dabei neugegründeten Verein tauften sie auf den Namen 1. Fußballclub Nürnberg und beschlossen als Mitglieder einzutreten. Im Vergleich zu seinen beiden 1897 und 1898 gegründeten Vorgängern, die nur wenige Monate bestanden, konnte sich der 1900 ins Leben gerufene und heute noch bestehende Verein durchsetzen, gerade auch, weil er ab 1901 das Rugby aufgab und sich, orientiert an der englischen Football Association, dem „Fußball ohne Aufnehmen des Balles“ zuwandte.

Luftbild der Deutschherrnwiese bei der Kleinweidenmühle, mehrere Fußballtore sind auf den Plätzen zu erkennen. Foto Photogrammetrie München, August 1926. (StadtAN A 97 Nr. 264)
Vor der Vereinsgründung spielte der 1. FCN zunächst auf dem oberen Teil Deutschherrnwiese. Zu dieser Zeit wurde dieses Areal allerdings noch häufig durch das Militär genutzt, sodass Torstangen und Eckpfosten vor dem Spiel immer wieder aufs Neue aufgebaut und nach dem Spiel abgebaut werden mussten. Das benachbarte Gasthaus „Zur Burenhütte“ diente als Vereinsheim und Umkleideraum. Nach einem besonders starken Regenguss zog man auf den trockenen unteren Teil der Deutschherrnwiese um. Das Besondere an dieser Entwicklung ist die Tatsache, dass hier – durch den Verkauf von Programmen – erstmals Eintrittsgelder eingeführt wurden. Dort war aber eine Einzäunung des Platzes nicht möglich, was rasch die Suche nach einem neuen Platz erforderlich werden ließ. Die Entscheidung fiel auf den Platz an der Ziegelgasse in Steinbühl, der am 21. September 1905 eingeweiht wurde. Ein weiterer Umzug erfolgte nach Schweinau in die Maiachstraße. Das Eröffnungsspiel fand am 27. September 1908 gegen Wacker München statt. Insgesamt stieg die Kapazität der Spielstätte auf die doppelte Größe an, so fanden sich 1910 ganze 4.000 Zuschauer zu einem Spiel ein. Es gab ein Klubhaus mit Bewirtschaftung sowie eine kleinere Holztribüne mit Umkleideraum, Waschraum und Duscheinrichtungen, was eine Neuheit für Nürnberg darstellte. Rund um die Laufbahn wurden Ansätze von Zuschauerwällen geschaffen, aber bereits im Herbst 1911 beim Derby gegen Fürth war dieser Prototyp des Stadions den Anforderungen sowie dem Andrang des Publikums nicht mehr gewachsen. 1911/12 entschied sich der Vorstand dazu, ein circa 47.000 Quadratmeter großes Grundstück zu erwerben, um dieses als eigenen Platz zu nutzen. Die Wahl fiel auf ein Grundstück im außerhalb gelegenen Zerzabelshof. Das Ziel hierbei war es, unter anderem auch die im Stadtgebiet Nürnberg verhängte Lustbarkeitssteuer zu umgehen. Der 1913 eröffnete Platz wurde mit Übungsplätzen, einem Stadion, einem Klubheim und Tennisplätzen großzügig gestaltet und wurde als der „Zabo“ bekannt.

Blick zur Tribüne am Sportplatz in Zerzabelshof. Foto, Hochbauamt 1920. (StadtAN A 38 Nr. C-121-3)
Von der Clubgründung bis zur Zeit der Weimarer Republik –
Nürnberg als Hochburg des deutschen Fußballs
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Fußballsport zum Massenphänomen und nahm großen Einfluss auf das kulturelle und gesellschaftliche Leben. Dies war nicht zuletzt auch den Veränderungen zur Zeit der Weimarer Republik geschuldet, wie der Einführung des freien Samstags, steigenden Löhnen sowie der Ausweitung des Eisenbahnnetzes. Insgesamt verfügten die Menschen über mehr Freizeit und finanzielle Mittel, was sich besonders im Bereich des Sports deutlich zeigte. Gerade die Ausweitung des Eisenbahnnetzes bewirkte eine deutlich bessere Vernetzung, wodurch auch größere Entfernungen zurückgelegt werden konnten, um Auswärtsspiele besuchen zu können. An den Zuschauerzahlen zeigt sich der enorme Aufschwung des Fußballs deutlich: beim Endspiel 1914 in Magdeburg waren 6.000 Zuschauer anwesend, während es 1920 in Frankfurt schon 25.000 Zuschauer waren. Nur zwei Jahre später beim Endspiel gegen den HSV in Leipzig waren es bereits 50.000. Der 1. FCN überzeugte in dieser Zeit – vor allem von 1916 bis 1929 – durch eine beeindruckende Abfolge von Gewinnen und verdiente sich so für sich und die Stadt Nürnberg den Namen einer Fußball-Hochburg. Aus diesem Grund wurde der „Zabo“ nach dem Ersten Weltkrieg schrittweise ausgebaut: Das Stadion wurde auf ein Fassungsvermögen von 25.000 Zuschauern erweitert und ein Gefallenendenkmal wurde an der Nordkurve des Wettspielplatzes errichtet. Der Begriff „Zabo“ für das Stadion wurde von Clubmitglied Alfred Fleinert 1915 geprägt – bis heute ist der „Zabo“ als überaus bedeutende Spielstätte für den 1. FCN unvergessen. Der Club konnte hier große Erfolge verzeichnen und dominierte den deutschen Fußball, besonders in den 1920er-Jahren. Nürnberg wurde zur spielerischen Hochburg und der „Zabo“ zum Sinnbild des Erfolgs. Bereits 1926 galt der „Zabo“ – nach seiner Fertigstellung – als schönster Sportpark Deutschlands.

Der Lageplan des Sportparks Zerzabelshof aus dem Buch „Deutschlands Kampfbahnen“, veröffentlicht 1928. Hervorgehoben wird, dass unter den Vereinsanlagen die des 1. FCN zu den "besten und größten ihrer Art" gehöre, der Sportpark, so heißt es dort weiter, "stellt eine Anlage dar, wie sei wohl jedem Verein als Ideal vorschwebt, aber nur den allerwenigsten erreichbar ist". (StadtAN Av 7913.8)
Der Bau des Städtischen Stadions 1926 bis 1928
Der Ruf Nürnbergs als Sporthochburg Deutschlands fand seinen sichtbaren Ausdruck in dem zwischen 1926 und 1928 auf dem Zeppelinfeld errichteten Stadion, das als Teil einer größeren Sport- und Freizeitanlage nahe des Dutzendteichs geplant wurde. Neben dem Stadion gehörten zu dieser Gesamtanlage auch ein Leichtathletikstadion, eine Spiel- und Festwiese, vier Fußballübungsplätze mit Leichtathletikanlagen und eine Tennisplatzanlage mit zwölf Übungsfeldern. Angebaut wurde auch ein Schwimmstadion mit Sprungturm, Liegewiesen, Sonnenterrassen und Planschbecken. Diese Gesamtanlage zählte zu den größten und modernsten der Welt und war vom Nürnberger Stadtgartendirektor Alfred Hensel (1880–1969) geplant worden, für die Planung der Hochbauten zeichnete der Architekt Otto Ernst Schweizer (1890–1965) verantwortlich. Der Nachlass von Alfred Hensel befindet sich im Stadtarchiv Nürnberg und ist unter der Signatur E 10/13 vollständig verzeichnet, darunter befinden sich auch die Lagepläne zum Stadion auf dem Zeppelinfeld. Bei einem Architekturwettbewerb im Kontext der Olympischen Spiele 1928 in Amsterdam wurde er für sein Gesamtkonzept und seine räumlich-städteplanerische Leistung mit der Goldmedaille ausgezeichnet. In diesem Kontext wurde auch das Stadion als das schönste Stadion der Welt geehrt. Am 10. Juni 1928 wurde das Städtische Stadion mit einer Kapazität von rund 40.000 Zuschauern und mit seinem bis heute noch eindrucksvollen Markenzeichen der achteckigen Form eröffnet. Die bemerkenswert kurze Bauzeit verdankte sich einer Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt, welches bis zu 10.000 Erwerbslose aus Nürnberg und dem Umland für Erd- und Gartenarbeiten vermittelte. Vom Bauhausstil zeugt noch die Fassade der Haupttribüne, die daher unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Die im Bau befindliche Tribüne des Stadions. Foto Hochbauamt: Kurt Grimm, 1928. (StadtAN A 38 Nr. D-45-8)
Bereits 1929 wurde das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1928/29 in diesem Stadion ausgetragen sowie auch das 2. Deutsche Arbeiter-Turn- und Sportfest der Arbeitersportbewegung hier veranstaltet. Zu den sportlichen Höhepunkten dieser Art gesellte sich der Stolz über die neu errichtete Sportanlage, wie eine Postkarte zum 2. Deutschen Arbeiter-Turn- und Sportfest beispielhaft zeigt. Nicht nur das Interesse am Fußball, sondern auch an anderen Teilen der Anlage spiegelte sich hier wider. Oftmals wurde auch die Gesamtanlage zum Motiv solcher Ansichtskarten.
Das Stadion war Großveranstaltungen wie nationalen Sportfesten oder Länderspielen vorbehalten. Der 1. FCN spielte zunächst weiterhin in seinem „Zabo“ und erst in der Nachkriegszeit im Stadion.

Die von Otto Ernst Schweizer entworfene Tribüne des Stadions nach ihrer Fertigstellung. Foto Hochbauamt: Kurt Grimm, 1929. (StadtAN A 38 Nr. C-3-2)
Im Schatten der NS-Ideologie – Die dunklen Jahre des Stadions
Das NS-Regime beeinträchtigte auch das Vereinswesen in Nürnberg: So wurden Vereine – insbesondere die der Arbeiterbewegung – zerschlagen oder der neuen Ideologie unterworfen. Bereits am 9. Juli 1933 wurde alle Vereine gleichgeschaltet, das heißt sie wurden im nationalsozialistischen Sinn umgestaltet und die Mitglieder mussten „arischer Abstammung“ sein. Für den 1. FCN muss allerdings angemerkt werden, dass im Verwaltungsausschuss bereits vor der Gleichschaltung aller Vereine beschlossen worden war, dass jüdische Mitglieder nicht länger Teil des Vereins sein durften. Aber nicht nur die Haltung der Mitglieder wurde durch den Nationalsozialismus gravierend beeinflusst, sondern auch das Stadion wurde vereinnahmt und fortan anders genutzt. Ab 1933 bezogen die Nationalsozialisten die Arena in ihre Parteitagsveranstaltungen ein. Während der NS-Reichparteitage diente das Städtische Stadion als Austragungsort der sogenannten NS-Kampfspiele sowie als Schauplatz und Aufmarschort der Hitlerjugend. Nicht zuletzt deshalb wurde es auch als „Stadion der Hitlerjugend“ bekannt.
Nach Kriegsende wurde das Stadion zunächst als „Victory Stadium“ von den Amerikanern genutzt. 1961 wurde das Stadion dann von der US-Armee vollständig zur Nutzung an die Stadt Nürnberg übergeben. Der Schwerpunkt lag hierbei vor allem in den 1950/60er-Jahren auf der Nutzung für große Leichtathletikveranstaltungen.
Nach 1945 – „Zabo II“, der Stadionumbau 1963 und schließlich das Frankenstadion 1991
Nach dem Zweiten Weltkrieg musste die „Zabo“-Ruine – so war die hölzerne Haupttribüne zerstört worden – wieder neu auf- und ausgebaut werden. Am Ende dieses Prozesses stand ein Stadion mit einem Fassungsvermögen von 35.000 Zuschauern, das als „Zabo II“ bekannt wurde. In den nächsten Jahren ergaben sich allerdings einige Nachteile, die weitere Veränderungen erforderlich werden ließen. Vor allem polizeiliche Auflagen konnten nicht erfüllt werden und der ausgebaute Sportpark genügte den Standards der Bundesliga nicht. Zudem spielte auch der zunehmende Autoverkehr eine wichtige Rolle. In der Folge fand der Umzug der 1. Mannschaft ins Städtische Stadion am Dutzendteich statt, was zugleich den Beginn eines neuen Entwicklungsabschnitts ab 1963 markierte. Ein wichtiger Faktor für diese Entwicklung war die erneute Deutsche Meisterschaft des 1. FCN 1961. Das Stadion wurde zunächst durch Stahlrohrtribünen seitlich der Haupttribüne erweitert und erhielt eine Flutlichtanlage, um vor allem den Anforderungen der Fußball-Bundesliga zu entsprechen. In den Jahren 1987 bis 1991 erfuhr das Stadion eine umfassende Generalsanierung und Renovierung. Das Stadion war baulich betrachtet überaltert und Sicherheitsstandards konnten nicht erfüllt werden. In diesem Zuge kamen Forderungen nach einer grundlegenden Sanierung auf. Das Ziel des Konzepts war es, ein Stadion zu schaffen, das als moderner und multifunktionaler Veranstaltungsort fungiert. In dieser Zeit war auch die politische Sichtweise auf das Stadion keine unwichtige Komponente. Im Vorfeld der 1987 anstehenden Oberbürgermeisterwahl wurde ein neues Stadion zu einem der wichtigsten Argumente der Kandidaten Peter Schönlein (1939–2016) und Günther Beckstein. Letztlich gelang es Günther Beckstein in seiner vermittelnden Rolle zwischen Stadt und Freistaat, den bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß (1915– 1988) für die staatliche Unterstützung des Projekts zu gewinnen. Nach dem Entwurf von Günther W. Wörrlein und Gerhard Thiele (1938–2025) entstand in aufwendigen Umbaumaßnahmen unter Weiternutzung der alten Arena die neue Anlage des Stadions. 1991 wurde die neue überdachte Anlage in Frankenstadion umbenannt und im September desselben Jahres mit einem Volksfest eingeweiht. Die Gesamtkosten für die Anlage, die fortan auch für größere Leichtathletikveranstaltungen ausgestattet war, beliefen sich auf 68,1 Millionen DM. Im Nachgang fanden noch die Renovierung des Stadionbads 1999 sowie der Neubau der Eis-Arena statt.

Blick von der Gegengerade auf die Haupttribüne und das Spielfeld im Max-Morlock-Stadion. Foto Stadtarchiv Nürnberg: Marta Beck, 28.9.2024. (StadtAN A 96 Nr. 6945)
Die Namensgebung im Wandel
Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wurde das Frankenstadion von 2002 bis 2005 nochmals umfassend modernisiert, um den Standards der Veranstaltung zu genügen. Zu den wesentlichen Veränderungen zählten die Absenkung des Spielfelds, der Einbau von VIP-Logen, ein VIP-Gebäude hinter der Haupttribüne und andere Ergänzungsbauten, darunter auch eine „Fan-Hall“. Das Frankenstadion wurde 2006 in „FIFA-WM-Stadion Nürnberg“ umbenannt. Im Zuge der Kommerzialisierung des Fußballs wurde der Name an die in Nürnberg ansässige Norisbank verkauft und das Stadion erhielt nicht den Namen des Kreditinstituts, sondern eines von ihm vertriebenen Produkts: „easyCredit“. Nach einer kurzen Periode mit dem Namen „Grundig-Stadion“ erhielt es 2017 zur Ehrung des 1994 verstorbenen Nürnberger Fußballspielers den Namen „Max-Morlock-Stadion“.
| Dieser Artikel erschien in ähnlicher Form im Norica-Heft Nr. 21 mit dem Rahmenthema Sport. Weitere Artikel befassen sich mit den „Goldenen Zwanzigern“ des 1. FCN, dem Deutschen Turnfest im Jahr 1903, dem Sportjournalisten Hanns Schödel, der Zeit Nürnbergs als Fahrradhochburg oder der Geschichte des Sportartikelherstellers Kaspar Berg. Das Heft kann zum Preis von 6 Euro im Stadtarchiv Nürnberg und in folgenden Buchhandlungen erworben werden: Universitätsbuchhandlung Korn & Berg am Hauptmarkt 9, Buchhandlung Jakob am Hefnersplatz 8, Buchhandlungen Schmitt & Hahn im Nürnberger Hauptbahnhof und im Albrecht Dürer Airport Nürnberg. |